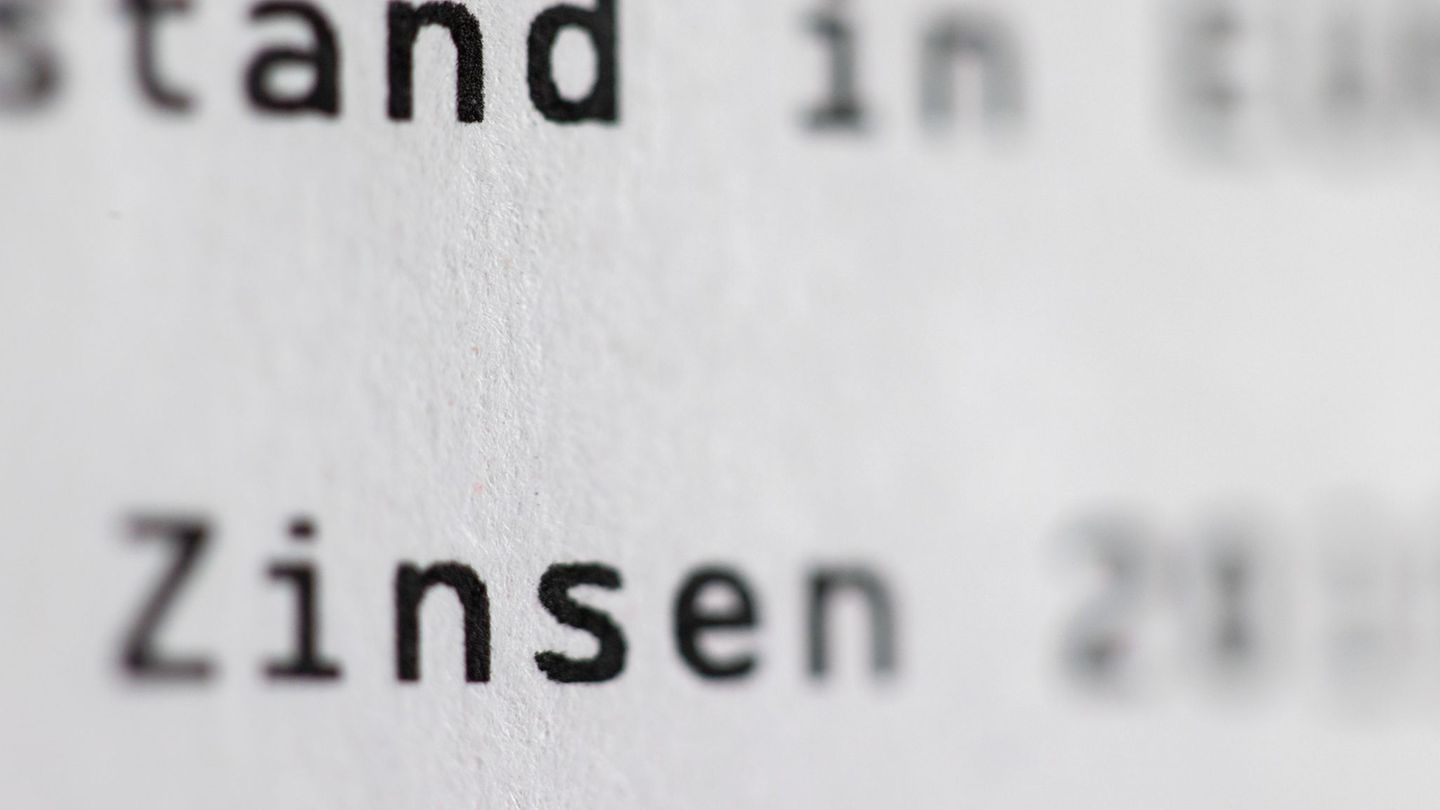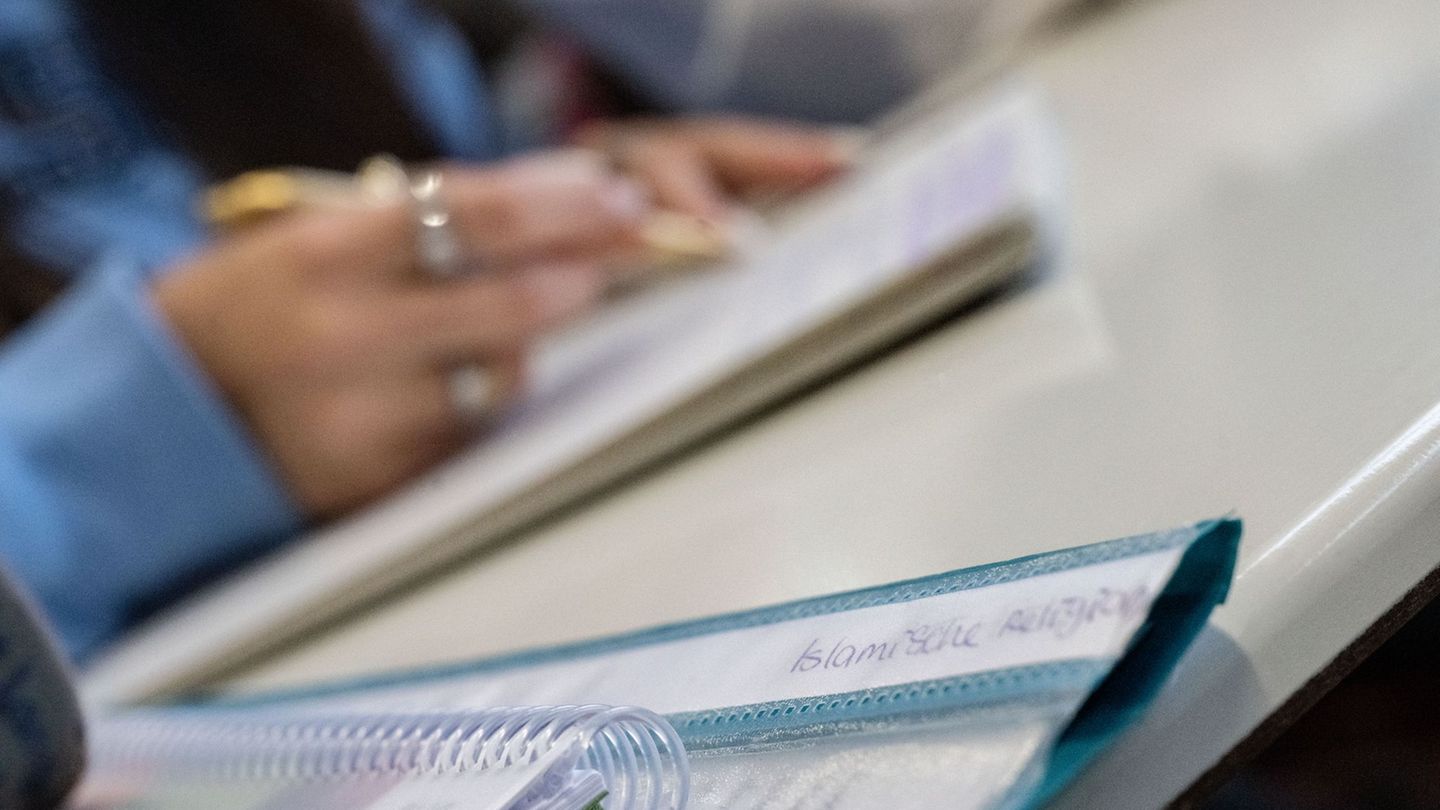Kulturprotest gegen AfD: Wer sind die Schauspieler, die hunderte Promis gegen Merz mobilisierten?
Über 500 Stars haben einen Protestbrief gegen Friedrich Merz‘ Abstimmung mit der AfD unterschrieben. Die Initiatoren Jonathan Berlin und Luisa-Céline Gaffron im stern-Interview.
So viele namhafte Künstler, Musiker und Schauspieler haben sich lange nicht mehr für einen politischen Appell zusammengetan: Mehr als 500 Kulturschaffende – unter ihnen Jasna Fritzi Bauer, Maren Kroymann, Bela B. und Sabrina Setlur – haben einen offenen Brief zur Erhaltung der Brandmauer unterzeichnet, initiiert von Luisa-Céline Gaffron, 31, und Jonathan Berlin, 30. Die in Berlin lebenden Schauspieler engagieren sich schon länger politisch und setzten sich 2023 mit einer Petition zur Unterstützung der Klimademonstranten in Lützerath ein. Im stern-Interview erzählen sie, wie sie es geschafft haben, innerhalb von 48 Stunden eine so breite Unterstützung zu mobilisieren und warum sich Künstler auch politisch einmischen sollten.
Was war der konkrete Auslöser für den offenen Brief – und warum halten Sie es gerade jetzt für so wichtig, Stellung zu beziehen?
Jonathan Berlin: Weil wir bei Demokratie alle gemeint sind. Wir müssen jetzt aktiv werden. Der konkrete Auslöser war die Ankündigung von Friedrich Merz, die Stimmen der AfD in Kauf zu nehmen, um seine Vorhaben zur Migrationspolitik durch den Bundestag zu bringen – Vorhaben, die übrigens kaum mit EU-Recht vereinbar sind. Uns wurde klar, dass es nun maximalen öffentlichen Druck braucht, um deutlich zu machen: Wenn ihr die Brandmauer fallen lasst, müssen wir sie sein.
Am Ende hatten wir einen Schneeballeffekt
Innerhalb von nur 48 Stunden haben sich zahlreiche prominente Kulturschaffende Ihrem Aufruf angeschlossen. Wie ist es Ihnen gelungen, diese breite Unterstützung so schnell zu mobilisieren?
Luisa-Céline Gaffron: Wir haben zunächst unser eigenes Netzwerk aktiviert – Kolleg:innen, mit denen wir schon lange in Kontakt stehen. Dann haben Agenturen, andere Kulturschaffende und engagierte Menschen den Brief weitergetragen, sodass er sich in kürzester Zeit verbreitet hat. Am Ende hatten wir einen Schneeballeffekt. Mein Eindruck war, dass viele froh waren, einen Kanal zu finden, um ihrer Empörung Ausdruck zu verleihen.
Die Bundestagsabstimmung über den Fünf-Punkte-Plan zur Grenzsicherung war die erste, bei der die CDU eine Mehrheit mit den Stimmen der AfD gesucht hat. Warum sehen Sie darin einen „historischen Tabubruch“?
Jonathan Berlin: Weil die Ereignisse der letzten Tage zeigen, dass die Brandmauer zur AfD vonseiten der Union kaum noch existiert. Die Union hat durch die gemeinsame Abstimmung eine zum Teil rechtsextreme Partei faktisch legitimiert. Wir befinden uns nun in einer Situation, in der befürchtet werden muss, dass sich solche gemeinsamen Abstimmungen und Zusammenarbeiten wiederholen könnten und die Macht der Rechtsextremen weiter ausbauen. Das haben wir in der Geschichte schon einmal erlebt. Wer aus der Vergangenheit nichts lernt, riskiert, sie zu wiederholen.
Friedrich Merz hatte eine Zusammenarbeit mit der AfD immer wieder ausgeschlossen. Hat es Sie überrascht, dass er so schnell wortbrüchig wurde – oder war das absehbar?
Luisa-Céline Gaffron: Es hat mich nicht wirklich überrascht. Die Rhetorik von Friedrich Merz hat sich in den letzten Monaten immer weiter radikalisiert und in eine Richtung entwickelt, die diese Zusammenarbeit wahrscheinlicher gemacht hat. Dass es aber so schnell und so offen passiert ist, zeigt, wie instabil seine Integrität ist und wie opportunistisch seine politischen Versprechen sind. Nichts, was man sich von einem Bundeskanzler wünscht.Rekonstruktion Merz 6:05
Welche Reaktionen hat Ihr offener Brief hervorgerufen?
Jonathan Berlin: Zum größten Teil haben uns Stimmen von Menschen erreicht, die sehr dankbar waren, dass hier eine Branche ihre Stimme erhebt, deren Vertreter:innen für einige auch Identifikationsfiguren sind. Wir waren froh, dass der Brief ein hohes mediales Echo bekommen hat, weil das den Druck erhöhen kann. Gleichzeitig gibt es natürlich auch Kommentare, bei denen man merkt, wie tief rechte Rhetorik und Hetze bereits in unsere Gesellschaft eingedrungen sind. Schock und Mitgefühl nach Aschaffenburg und Magdeburg teilen wir selbstverständlich, doch die rassistischen, verschwörungsideologischen Schlüsse, die einige daraus ziehen, sind meilenweit entfernt von dem, was eine Gesellschaft ausmacht: sachorientierte Lösungen erarbeiten, Zusammenhalt oder zumindest Respekt über alle Herkünfte, Hintergründe und Schichten hinweg – und vor allem Empathie.
Gab es Rückmeldungen, die Sie besonders überrascht oder gefreut haben? Und welche, die Sie nachdenklich gemacht haben?
Luisa-Céline Gaffron: Mich hat besonders gefreut, wie viele Menschen aus völlig unterschiedlichen Bereichen sich dem Protest angeschlossen haben – auch solche, die vielleicht vorher nicht so politisch aktiv waren. Nachdenklich gemacht hat mich, wie viel Hass und Desinformation in der Debatte stecken. Es ist erschreckend, wie wenig faktenbasiert viele Diskussionen geführt werden und wie manchmal vergessen wird, dass dieser Diskurs und diese Gesetze reale, schwerwiegende Konsequenzen für Menschen haben.
Es steckt viel Hass in der Debatte
In Ihrem offenen Brief ziehen Sie Parallelen zur deutschen Geschichte, insbesondere zur NS-Zeit. Warum halten Sie diese Vergleiche für notwendig?
Jonathan Berlin: Wer morgens der Holocaust-Opfer gedenkt, um nachmittags mit den ideologischen Erben der Täter von damals für Gesetze zu stimmen, die Rechte gefährden, die aus Lehren der NS-Zeit entstanden sind – der braucht offensichtlich eine sehr scharfe Erinnerung an das, was sie alle so oft in Sonntagsreden versprochen haben: „Nie wieder!“
01: Zehntausende demonstrieren für Vielfalt und die «Brandmauer» – 4f277415aeed7fa6
In den USA haben zahlreiche Künstler wie Taylor Swift oder Robert De Niro im Präsidentschaftswahlkampf offen gegen Donald Trump Stellung bezogen – ohne dessen Erfolg verhindern zu können. Welche politische Wirkungsmacht hat die Kultur in Deutschland?
Luisa-Céline Gaffron: Kunst kann keine Wahlen gewinnen oder verhindern, aber sie kann gesellschaftliche Debatten prägen. Wir als Kunstschaffende sollten nicht davor zurückscheuen, unseren Anteil im Diskurs zu leisten.
Jonathan Berlin: Ich denke, wir haben in den USA gesehen, dass sich zwar einige Prominente zu Harris bekannt haben, aber in der Summe doch erstaunlich wenige, wenn man bedenkt, was da auf dem Spiel stand. Bei einer Wahl, die so auf Messers Schneide stand, wäre einiges möglich gewesen, wenn sich Hollywood besser organisiert hätte und mit einer gemeinsamen Stimme für Harris bzw. gegen Trump gesprochen hätte. Wieso das nicht geschlossener geschehen ist, diese Frage muss sich die Branche in den USA sehr ernsthaft stellen.
Was erhoffen Sie sich konkret von diesem offenen Brief? Und wie soll es nach diesem ersten Schritt weitergehen?
Jonathan Berlin: Wir waren erstmal unheimlich erleichtert, dass der Gesetzesentwurf abgelehnt wurde. Das war ein erstes Etappenziel, das erreicht wurde. Und trotzdem ist der Schaden angerichtet und immens. Gerade deshalb hoffen wir, dass sich der Stimme des Briefes noch viel mehr anschließen, selbst aktiv werden, auf Demos gehen und sich in den nächsten Wochen in vielerlei Hinsicht einbringen, um gegen Rechts aufzustehen, unsere Demokratie und die Vielfalt in unserem Land zu verteidigen.
Wie erleben Sie persönlich als Schauspieler Versuche der AfD, die Kulturlandschaft politisch zu instrumentalisieren – sei es durch Forderungen nach Kürzungen staatlicher Zuschüsse für Theater oder durch den Versuch, ein „deutsches Leitbild“ in der Kultur zu etablieren?
Luisa-Céline Gaffron: Es ist brandgefährlich. Kunst lebt von Vielfalt, von Widerspruch, von offenen Diskursen. Wenn eine Partei anfängt zu bestimmen, welche Kunst gefördert wird und welche nicht, dann ist das der Anfang einer kulturpolitischen Gleichschaltung. Die AfD will eine „deutsche“ Kultur definieren – aber Kunst kann und darf nicht nationalistisch sein. Wir müssen wachsam bleiben, denn die Freiheit der Kunst ist einer der ersten Bereiche, die autoritäre Bewegungen angreifen. Ich glaube manchmal, dass die Rechten sich davor fürchten, wie viel Fantasie wir haben, dass wir uns nicht in den Käfig der aktuellen Realität sperren lassen und ihn akzeptieren, sondern immer weiter um diese Welt und ein Miteinander ringen. Deswegen greifen sie diese Arbeit an. Aber Fantasie und Empathie sind etwas sehr Kraftvolles – und das kann uns niemand wegnehmen oder kontrollieren.